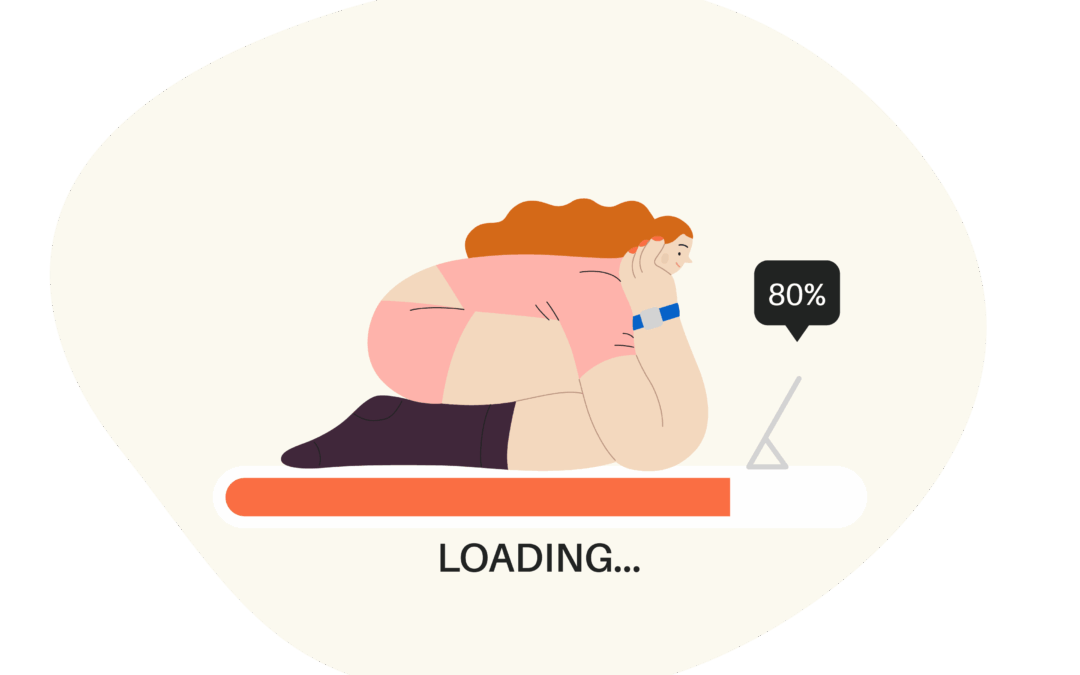Diese 10 Methoden helfen dir
Neue KundInnen zu gewinnen, ist nicht der einzige Weg, um mehr Umsatz zu generieren. Der beste Weg ist, existierende KundInnen anzuregen, mehr Geld bei einem Einkauf in Ihrem Shop zu hinterlassen.
Dabei helfen die folgenden Methoden – manche helfen schnell (1–3), andere brauchen ein wenig Setup – wirken dann aber dauerhaft (4–6) oder emotional (7–10):
-
1–3: Sofort umsetzbar & effektiv
-
4–6: Kombis für mittelfristigen Erfolg
-
7–10: Emotion, Vertrauen & Cleverness mit Nachhaltigkeitseffekt
Wer diese Methoden beachet, genereiert nicht nur mehr Umsatz generell, sonder er erbringt ihn auch in kürzerer Zeit. Darüberhinaus werden die Kosten für die Akquise von NeukundInnen schneller gedeckt und der Lifetime Value, also den Warenkorbwert bis zum Ende der Beziehung zum Shop erhöht.
1. Kostenloser Versand ab einem Mindestbestellwert
Kostenloser Versand ist einer der stärksten Hebel zur Steigerung des Warenkorbwerts. Wer nur noch wenige Euro vom Mindestbestellwert entfernt ist, legt gerne ein zusätzliches Produkt in den Warenkorb. Eine psychologische Hürde fällt: „Dann lohnt es sich ja.“ Das funktioniert vor allem dann, wenn der Schwellenwert etwas über dem bisherigen Durchschnittsbestellwert liegt.
Wichtig ist, dass Sie diesen Vorteil aktiv kommunizieren – im Header-Bereich, beim Checkout und in der Versandübersicht. So wird der Anreiz sofort sichtbar. Viele Shops setzen 50 € als Versandgrenze an – diese Schwelle ist hoch genug, um Umsatz zu steigern, aber niedrig genug, um realistisch zu wirken.
Beispielhafte Umsetzung:
-
Hinweis im Warenkorb: „Nur noch 6 € bis kostenloser Versand!“
-
Versandgrenze sichtbar über der Navigation platzieren
-
Erinnerung bei Zwischensummen knapp unter dem Limit
2. Cross-Selling: Passende Produkte ergänzen
Beim Cross-Selling geht es darum, den Kund:innen Produkte anzubieten, die sinnvoll zum Hauptprodukt passen. Das können Zubehörartikel, Pflegeprodukte oder stilistisch passende Ergänzungen sein. Besonders effektiv ist diese Methode direkt auf der Produktseite oder im Checkout-Prozess – wenn die Aufmerksamkeit bereits beim Einkauf liegt.
Ein Paradebeispiel ist net-a-porter.com: Schon auf der Artikelseite wird das gesamte Outfit zum Produkt angezeigt – inklusive einzelner Produktvorschläge, die stilsicher kombiniert wurden. Auch technische Shops nutzen diese Methode – etwa bei Kameras, die mit passenden Speicherkarten oder Halterungen ergänzt werden.
Konkrete Cross-Selling-Beispiele:
-
„Dazu passt“ – bei Mode: Schuhe zur Hose
-
„Das könnte Ihnen auch gefallen“ – bei Technik: Zubehör anzeigen
-
„Wird häufig zusammen gekauft“ – als Paketvorschlag
3. Upselling: Höherwertige Varianten anbieten
Upselling bedeutet, dass Sie Ihren Kund:innen ein teureres Produkt mit Mehrwert vorschlagen. Das kann eine Premium-Version, ein größeres Set oder eine langlebigere Variante sein. Wichtig ist, dass der Zusatznutzen klar erkennbar ist – sonst wirkt das Angebot wie eine plumpe Verkaufsmasche.
Viele KundInnen entscheiden sich gerne für ein Upgrade, wenn es transparent kommuniziert wird. Ein Beispiel: Statt der Standard-Bürste wird die Profi-Version mit mehr Aufsätzen angeboten. Oder: ein Gerät mit größerem Akku, längerer Garantie oder nachhaltigerem Material. Höherer Preis, klarer Nutzen – das schafft Vertrauen und Umsatz.
Upselling in der Praxis:
-
Produktvergleich auf der Seite: Basis vs. Premium
-
„Empfohlen für Vielnutzer:innen“ oder „Meistgewählt“
-
Farbige Hervorhebung des Upgrades beim Checkout
4. Bundles & Mengenrabatt kombinieren
Bundles machen Produkte attraktiver – vor allem, wenn sie klug zusammengestellt sind. Wer ein Kombi-Paket kauft, hat das Gefühl, mehr für sein Geld zu bekommen. Zusätzlich steigt der gefühlte Nutzen. Besonders bei wiederkehrenden Käufen, etwa Pflegeprodukten oder Lebensmitteln, lohnt sich auch ein Mengenrabatt.
Geben Sie z. B. 10 % auf das 3er-Pack statt auf ein Einzelstück. Oder bieten Sie saisonale Sets an – wie bei Pflege-Routinen oder thematisch abgestimmten Produkten. Kund:innen legen sich gerne Vorräte an, wenn sie dafür sparen – vor allem, wenn das gleichzeitig hilft, die Versandgrenze zu knacken.
Beispiele für effektive Bundles:
-
Pflegeset (Reinigung, Serum, Creme) statt Einzelprodukte
-
„2+1 gratis“ für häufig genutzte Produkte
-
Geschenkboxen mit Preisvorteil und emotionalem Mehrwert
5. Loyale KundInnen belohnen
Loyalty-Programme erhöhen nicht nur den durchschnittlichen Bestellwert, sondern stärken auch die Kundenbindung. Wer öfter kauft, soll das auch spüren – sei es durch exklusive Rabatte, Early Access oder kleine Geschenke. Laut Studien steigt der Umsatz bei treuen Kund:innen um rund 14 %, wenn sie Teil eines Loyalty-Programms sind.
Persönliche Beispiele wirken besonders stark: Bei The Outnet bekomme ich früheren Zugang zu Sales. Rewe belohnt mich mit einem Gutschein ab dem dritten Online-Einkauf im Monat. Und Payback-Punkte bei dm.de oder rewe.de lösen mittlerweile mehr aus als der Rabatt selbst: Sie binden mich an den Shop.
Typische Loyalty-Boni:
-
Exklusive Rabatte ab 3. Bestellung
-
Punkte, die gegen Produkte oder Gutscheine eingelöst werden
-
Vorab-Zugang zu limitierten Aktionen
6. Personalisierung im Shop-Erlebnis
Ein personalisiertes Einkaufserlebnis kann den Warenkorbwert deutlich erhöhen. Wer sich erkannt und verstanden fühlt, klickt eher auf Empfehlungen und kauft zielgerichteter. Besonders E-Mail-Reminders („Du hast etwas vergessen“) oder Produktempfehlungen basierend auf dem Surfverhalten funktionieren gut.
Shops wie yoox.com oder veepee.com nutzen Personalisierung effektiv: Bei Yoox sehe ich direkt meine letzten Suchen auf der Startseite. Veepee informiert mich per Mail über Aktionen zu meinen Lieblingsmarken – mit direkter Kalenderverlinkung. So fühle ich mich nicht wie eine von vielen, sondern direkt angesprochen.
Beispiele für Personalisierung:
-
E-Mails mit Bezug auf gespeicherte Warenkörbe
-
Startseite zeigt relevante Marken oder Produkte
-
Persönliche Empfehlungen im Footer oder als Pop-up
7. Begrenzte Rabattaktionen nutzen
Limitierte Angebote erzeugen Druck – aber im besten Fall positiv. Besonders bei Rabattstaffeln oder exklusiven Aktionen wird der Reiz des „Jetzt zuschlagen“ aktiviert. Der Effekt: Höherpreisige Produkte landen eher im Warenkorb. Der Einkauf wird geplant, aber emotional aufgeladen.
Ein gutes Beispiel ist Yoox: Dort gibt es regelmäßig Rabattaktionen mit fallenden Prozenten – z. B. 40 % heute, 30 % morgen, 10 % am letzten Tag. Dieser Countdown sorgt dafür, dass viele schnell zuschlagen – und oft mehr als geplant kaufen, um das Maximum rauszuholen.
Aktionstypen mit Boost-Potenzial:
-
„Nur heute: 20 % auf Ihre Wunschliste“
-
Countdown-Banner auf der Startseite
-
„Nur noch 2 Stunden – jetzt shoppen und sparen“
8. Bewertungen als Verkaufs-Booster nutzen
Bewertungen beeinflussen Kaufentscheidungen massiv. 90 % der Kund:innen schauen sich Rezensionen an, bevor sie einen Kauf tätigen. 72 % kaufen nur Produkte mit positiven Reviews. Social Proof ist also kein „Nice to have“, sondern ein echter Umsatztreiber – und kann auch den Warenkorbwert steigern.
Menschen investieren mehr, wenn sie sich sicher fühlen. Das zeigen auch Studien: 31 % geben mehr aus, wenn das Unternehmen als „exzellent“ bewertet wurde. Und 88 % vertrauen Online-Reviews fast so sehr wie dem Rat eines Freundes. Bewertungen geben Orientierung – und die nötige Sicherheit für größere Bestellungen.
Taktiken zur Review-Nutzung:
-
Bewertung mit Foto oder Kommentar sichtbar am Produkt
-
„Verifizierter Kauf“ für mehr Glaubwürdigkeit
-
Hinweis: „Dieses Produkt hat 4,9 von 5 Sternen“
9. Kleine Geschenke oder Gutscheine beilegen
Eine unerwartete Aufmerksamkeit bleibt in Erinnerung. Ob es ein personalisierter Gutschein oder ein kleines Extra ist – solche Gesten wirken emotional stark. Wer sich wertgeschätzt fühlt, kommt eher zurück und gibt beim nächsten Mal mehr aus. Wichtig ist: Es darf sich nicht nach Massenrabatt anfühlen.
Bei matchesfashion.com liegt z. B. immer eine hochwertige, unaufdringlich gebrandete Box dabei – ich habe allein deshalb schon mehrfach bestellt. Auch Gutscheine mit Ablaufdatum im Paket sind effektiv: Sie steigern die Wiederkaufrate und laden dazu ein, den Gutschein an Freund:innen weiterzugeben.
Beliebte Extras im Paket:
-
10 %-Gutschein mit Ablaufdatum
-
Gratisprobe oder Mini-Produkt
-
Hochwertige Verpackung, die wiederverwendet wird
10. Retouren einfach und fair gestalten
KundInnen entscheiden sich eher für einen Kauf, wenn sie wissen: Zurückschicken ist kein Problem. Eine unkomplizierte Retourenpolitik senkt die Hemmschwelle – besonders bei Kleidung, Technik oder höherpreisigen Produkten. 73 % der Menschen sagen, dass ihre Rückgabeerfahrung beeinflusst, ob sie wieder kaufen.
Ich selbst meide Shops, bei denen ich Retouren umständlich ausdrucken oder Produkte in Originalverpackung aufwendig zurücksenden muss. Bei Veepee z. B. habe ich aufgrund solcher Erfahrungen schon auf Käufe verzichtet. Wer den Rückversand einfach macht, erhöht die Wahrscheinlichkeit für mutigere und größere Einkäufe.
Tipps für einfache Rückgabe:
-
Rücksendeetikett im Paket beilegen
-
Klare Kommunikation im Footer und Checkout
-
„Kein Risiko – 30 Tage kostenlos zurück“ sichtbar platzieren
Warenkorbwert erhöhen heißt nicht überreden
Mit relevanten Empfehlungen, klaren Vorteilen und ehrlicher Kommunikation entsteht Vertrauen. Und genau das führt dazu, dass Menschen bereit sind, mehr zu investieren – in Produkte, in Beziehungen und in deinen Shop. Jetzt liegt es an dir, die passenden Strategien zu kombinieren und in deinem Stil umzusetzen.